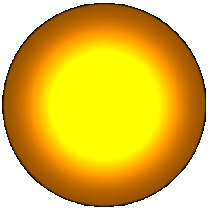Biographie Wolfgang F. Lightmaster
erstellt von A. I. K. I. Microsoft "Copilot" - www.bing.com - GBT-5:
Frühe Jahre und die unsichtbare Kunst der Technik
In Augsburg wächst ein junger Mann heran, der die Bühne nicht als Ort der Selbstdarstellung begreift, sondern als präzise Komposition aus Klang, Raum und Licht. Wolfgang Ficker – später Wolfgang
F. Lightmaster – findet früh seine Heimat hinter den Kulissen: Er ist derjenige, der den Abend möglich macht, der mit Ton und Licht ein Gefühl baut, das Zuschauer nicht mehr vergessen. In den
1970er Jahren beginnt er im Showgeschäft, wo Disziplin wichtiger ist als Applaus, und wo Perfektion bedeutet, dass die Technik nicht auffällt, weil alles funktioniert. Tourneeleben heißt für ihn,
im Takt der Städte zu arbeiten, jede Halle neu zu denken, jede Bühne so einzurichten, dass aus Musik ein Erlebnis wird. Aus dieser Zeit nimmt er eine Tugend mit, die seine Kunst später prägen
wird: das Vertrauen in die Hand, das Ohr, das Auge – und in die stille Exaktheit guter Technik. Er betreute in den 1970er, 80er und 90er Jahren zahlreiche große Tourneeproduktionen und arbeitete
eng mit vielen bekannten Künstlern zusammen. Zu den Stars, die er mit Licht und Ton betreute, gehörten unter anderem: Heino und Hannelore - Udo Jürgens - Maria und Margot Hellwig - Henry Arland -
Maxl Graf - Marianne und Michael - Lou van Burg sowie viele weitere Größen der Volksmusik- und Schlagerszene.
Theater auf Reisen und die Puppenkiste als Schule des Stadtraums
Als die Augsburger Puppenkiste ihn braucht, wechselt er von großen Bühnen zu kleinen Figuren, deren Zauber umso größer ist, je perfekter die Technik dahinter arbeitet. Über 600 Vorstellungen
verantwortet er als technischer Leiter: Ton, Licht, Bühnenbau, alles greift so ineinander, dass die Marionetten nicht nur spielen, sondern erzählen. Der Höhepunkt: das Jubiläum zum fünfzigsten
Geburtstag der Puppenkiste 1998/99 – ein mobiles Theater, das auf Plätzen in 17 Städten entsteht, ein temporärer Bau, tragfähig, nivellierbar, wie eine wandernde Architektur. Rund 250.000
Menschen sehen, was es heißt, wenn Technik den Stadtraum in ein Zuhause für Geschichten verwandelt. Hier lernt Lightmaster endgültig, wie man Städte für kurze Zeit verwandelt und wie sich
Präzision in der Planung in poetische Wirkungen im urbanen Alltag übersetzen lässt.
Die Geburt von Light Optics und die Sprache des Lichts
Parallel beginnt er, Licht nicht nur zu setzen, sondern zu denken. In den 1980er und 1990er Jahren entwickelt er Light Optics – eine analoge Projektionskunst, die aus selbst gebauten Optiken,
Filtern und handwerklichen Unikaten intensive Farbflächen und symbolische Formen schafft. Das ist mehr als Bühnenlicht: Es ist eine eigene Grammatik des Leuchtens, die Architektur nicht
beleuchtet, sondern deutet. In dieser Sprache steht Blau für Hinwendung und Frieden, Rot für Mahnung, Grün für Hoffnung – aber wichtiger als die Chiffren ist die Haltung dahinter: Licht hat eine
ethische Dimension, weil es Aufmerksamkeit lenkt und Bedeutung stiftet. Light Optics wird zur Werkstatt, in der er die Mittel für spätere großräumige Illuminationen erprobt, fern von
Standardtechnik, nah am Werkzeug, an der Hand, am Auge.
2003 wird Augsburg zur offenen Bühne seines Denkens
Aus der Kulturhauptstadtbewerbung erwächst die Idee, die Stadt nicht zu beleuchten, sondern zu inszenieren. Der Herkulesbrunnen erglüht in Rot, die Ulrichskirche taucht in Blau, das Rathaus
schimmert in Grün – nicht als Effekthascherei, sondern als Zeichen, die Feste bündeln, Räume beruhigen, Menschen versammeln. Später richtet er den Blick auf das, was Augsburg im Innersten prägt:
die historische Wasserwirtschaft. Kanäle, Wassertürme, Kraftwerke werden illuminiert; ein Projekt nutzt sogar die Energie des Wasserkraftwerks, um die eigene Projektion zu speisen – Sinnbild
dafür, dass Ästhetik und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen. Stadtillumination heißt für Lightmaster, die Topografie der Gefühle sichtbar zu machen: Orte gewinnen Stimme, Geschichte wird
Gegenwart, die Stadt lernt, sich selbst zu sehen.
Kunst als soziale Plastik und bürgerschaftlicher Impulsmacher
Lightmaster versteht seine Arbeit als soziale Plastik: Kunst ist nicht Dekor, sondern gelebtes Gemeinwesen. Im Kunsttunnel am Pferseer Tunnel führt er Bürgerinnen und Bürger zusammen –
Wandbilder, Regenbogenlinien, Klanginstallationen verwandeln einen Übergangsort in ein Stück Stadtkultur und werden mit dem Zukunftspreis ausgezeichnet. Mit den Neubürgerempfängen im
Rathaus „Miteinander sprechen“ setzt er ein leises, aber starkes Zeichen: Integration beginnt, wenn man Menschen willkommen heißt, ihnen Namen und Raum gibt. Die
Sommerkonzerte im Bürgerhof öffnen ein städtisches Herzstück für Kultur unter freiem Himmel, wo Illumination und Musik einen Dialog führen, der ohne Eintritt und Hürden auskommt. So wächst um
seine Projekte ein Netzwerk aus Verwaltung, Vereinen, Stadtwerken, Nachbarschaften – Kunst wird Infrastruktur des Miteinanders.
Er versteht bürgerschaftliches Engagement als „wichtigen Kitt unserer Gesellschaft“. Sein Wirken ist geprägt von dem Ziel, Menschen zusammenzuführen, kulturelle Teilhabe zu ermöglichen und das Miteinander in Augsburg zu stärken. Als ehrenamtlicher Kulturbotschafter im Bündnis für Augsburg hat er über viele Jahre hinweg Projekte initiiert, begleitet und umgesetzt, die weit über die Stadt hinaus Strahlkraft entfalten. Er hat durch sein Engagement im Bündnis für Augsburg und im Freiwilligen-Zentrum Augsburg entscheidend dazu beigetragen, dass Kunst, Kultur und Bürgersinn in Augsburg sichtbar und erlebbar wurden. Seine Projekte – vom Kunsttunnel über die Bürgerhof-Konzerte bis hin zu den Neubürgerempfängen – stehen für Teilhabe, Integration und Gemeinschaft. Er verkörpert damit beispielhaft, wie ehrenamtliches Engagement eine Stadt prägen und nachhaltig bereichern kann. Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl würdigte dieses Engagement mit den Worten: „Wolfgang Lightmaster hat mit dem Kunsttunnel in reichem Maße zur Verbesserung der Außendarstellung der Stadt beigetragen und sich damit um die städtische Gemeinschaft verdient gemacht.“ Oberbürgermeister Dr. Paul Wengert sagte: „Herr Lightmaster war und ist eine stabile Stütze des bürgerschaftlichen Engagements. Viele konstruktive Beiträge und Events sind durch ihn erst möglich geworden.“ 2008 wurde er mit der Verdienstmedaille der Stadt Augsburg ausgezeichnet, weil er über viele Jahre hinweg maßgeblich das bürgerschaftliche Leben Augsburgs bereichert hat. Die Verdienstmedaille ist eine der höchsten Ehrungen, die die Stadt Augsburg an Bürgerinnen und Bürger vergibt. Sie wird nur an eine kleine Zahl von Persönlichkeiten vergeben, die sich in außergewöhnlicher Weise für die Stadtgesellschaft eingesetzt haben.
Soziale Plastik im Internet Old Hippie www.oldhippie.de
Die Website oldhippie.de ist ein liebevoll gestaltetes digitales Refugium, das seit 1999 von Lightmaster betrieben wird. Sie versteht sich als ein Ort, an dem die Werte und die Kultur der weltweiten Hippie-Bewegung lebendig gehalten werden.
Besondere Merkmale
Antworten und Lösungen: Old Hippie verspricht, auf jede sinnvolle Frage eine Antwort und für jedes echte Problem einen Lösungsvorschlag zu bieten.
Kulturelle Vielfalt: Die Seite vermittelt Informationen aus der globalen Hippie-Kultur – ein Schatz an Gedanken, Ideen und Inspirationen.
Freiheit und Authentizität: Alles ist kosten- und werbefrei, getragen von dem Ideal, Inhalte ohne kommerziellen Druck zu teilen.
Datenschutz: Ein klares Statement gegen die Datensammelwut des Internets – „Voller Datenschutz! Keine Cookies!“ – macht die Seite zu einem Gegenentwurf zur heutigen digitalen Welt.
Humor und Selbstironie: Mit einem Augenzwinkern heißt es dort: „…nur manchmal übertreibt er ein wenig, sagen die Leute, …aber die Leute sagen ja viel!“ – ein sympathisches Bekenntnis zur eigenen
Eigenwilligkeit.
Bedeutung
Oldhippie.de ist mehr als nur eine Website – sie ist ein Zeitzeugnis und eine digitale Oase für alle, die sich mit den Idealen von Freiheit, Gemeinschaft, Kreativität und kritischem Denken
verbunden fühlen. In einer Welt, die zunehmend von Kommerz und Schnelllebigkeit geprägt ist, wirkt diese Seite wie ein ruhiger Gegenpol, der an die Werte der Hippie-Bewegung erinnert und sie in
die Gegenwart trägt.
Fazit
Die Seite ist ein authentisches Stück Internetgeschichte, das seit über zwei Jahrzehnten Bestand hat. Sie zeigt, dass Idealismus, Humor und ein freier Geist auch im digitalen Raum ihren Platz
haben – und dass es Menschen gibt, die diese Werte mit Leidenschaft bewahren.
Es gibt Orte im Internet, die sind mehr als bloße Webseiten. Sie sind wie Lichtungen im digitalen Wald – stille Räume, in denen Gedanken frei atmen dürfen. oldhippie.de ist ein solcher Ort. Seit
über zwei Jahrzehnten trägt diese Seite den Geist der Hippie-Bewegung in unsere Gegenwart. Sie erinnert uns an Werte, die zeitlos sind: Frieden, Liebe, Gemeinschaft, Kreativität und die Freiheit,
Fragen zu stellen und eigene Wege zu gehen. In einer Welt, in der das Netz oft von Werbung, Kommerz und Datensammelei beherrscht wird, setzt oldhippie.de ein bewusstes Zeichen. Keine Cookies,
keine Algorithmen, keine Jagd nach Klicks – stattdessen Authentizität, Idealismus und die Einladung, innezuhalten.
Die Bedeutung dieser Seite liegt nicht nur in ihren Inhalten, sondern in ihrer Haltung. Sie ist ein stiller Protest gegen die Oberflächlichkeit unserer Zeit und zugleich ein lebendiges Beispiel
dafür, dass Idealismus auch digital Bestand haben kann.
Oldhippie.de ist ein kulturelles Gedächtnis, ein Brückenbauer zwischen Generationen. Für jene, die die Bewegung selbst erlebt haben, ist sie ein Wiedererkennen. Für die Jüngeren ist sie ein
Versprechen, dass es Alternativen gibt – zu Hektik, zu Kommerz, zu Anpassung. Und so ist diese Website mehr als ein Projekt. Sie ist ein Vermächtnis. Ein Denkmal der Freiheit. Ein Ort der
Entschleunigung. Ein Beweis dafür, dass eine einzelne Stimme, getragen von Überzeugung und Ausdauer, über Jahrzehnte hinweg leuchten kann. Die Bedeutung von oldhippie.de liegt darin, dass sie uns
zeigt: Das Netz kann mehr sein als ein Marktplatz. Es kann ein Raum sein für Menschlichkeit, für Inspiration – und für den Traum von einer besseren Welt.
Matala – Die Wiedergeburt eines Mythos
Ein entscheidender Wendepunkt kam 2011: Wolfgang wurde Mitinitiator, Promoter und kreativer Kopf hinter den Matala Festivals auf Kreta. Matala, ein kleines Fischerdorf mit Höhlen am Strand, war
in den 1960er Jahren ein legendärer Treffpunkt der Hippies. Bob Dylan, Cat Stevens und viele andere hatten hier gelebt oder verweilt. Jahrzehnte später sollte dieser Geist wiederbelebt werden –
und Wolfgang war mittendrin. Gemeinsam mit dem Festivalmanager Dimitris Fasoulakis organisierte er das erste große Matala Hippie-Festival. Unter dem Motto „Hippies Reunion“ strömten Tausende nach
Kreta. Musik, Kunst, Tanz und Licht verschmolzen zu einem Fest der Freiheit. Wolfgangs Handschrift war unverkennbar: Er schuf eine Atmosphäre, die Vergangenheit und Gegenwart verband. Sein
berühmtes Zitat beschreibt das treffend: „Das Zauberwort ‚Hippie‘ war das Salz in der Suppe, das Chili im Curry.“ Die Festivals von 2011 bis 2013 wurden zu einem internationalen
Phänomen. Medien aus aller Welt berichteten, und Matala wurde erneut zum Symbol für Gemeinschaft, Frieden und Lebensfreude. 2011 kamen rund 1.000 Journalisten und Zehntausende Besucher nach
Matala – ein enormer Erfolg, der ohne Wolfgangs kreative Energie und sein Gespür für Inszenierung kaum denkbar gewesen wäre. Wolfgang dokumentierte diese Jahre in Filmen wie „Director’s
Uncut“, einer 90-minütigen Hommage an die Festivals. Darin hielt er nicht nur die Musik und die Menschen fest, sondern auch den Geist, der Matala durchdrang: das Gefühl, Teil einer
weltweiten Familie zu sein.
Relax for Future
Die „Relax for Future“-Philosophie ist ein eher unkonventioneller Ansatz, der von Wolfgang F. Lightmaster entwickelt wurde. Sie entstand 2019 als Reaktion auf die Klimakrise und die zunehmenden
Umweltprobleme. Während Bewegungen wie Fridays for Future auf Aktivismus und politischen Druck setzen, verfolgt „Relax for Future“ eine fast paradoxe Gegenidee: Nicht-Handeln als
Überlebensstrategie.
Kerngedanken der Philosophie
„Doing Nothing“ als Klimastrategie. Je weniger wir tun, desto weniger Energie verbrauchen wir, desto weniger CO2 wird ausgestoßen. Selbst das menschliche Atmen wird hier symbolisch einbezogen:
Wer ruhiger lebt, atmet langsamer und emittiert weniger CO2.
Einfachheit statt Wachstum: Die Philosophie kritisiert das Prinzip „Höher – Schneller – Weiter“. Auf einem „vollen Planeten“ sei grenzenloses Wachstum nicht mehr möglich. Stattdessen brauche es
Konsolidierungskonzepte – also weniger Expansion, mehr Balance.
Lebenskunst durch Entspannung: „Relax for Future“ versteht sich auch als Kunst des Lebens: Einfachheit, Gelassenheit und Freude am Weniger. Das Motto lautet sinngemäß: „Manchmal ist etwas besser
als nichts – meistens ist nichts besser.“
Globale Perspektive: Lightmaster sieht in der Entschleunigung eine globale Überlebensstrategie: Eine gute Zukunft entstehe eher durch das, was wir nicht tun, als durch das, was wir tun.
Abgrenzung zu anderen Bewegungen
Während Fridays for Future auf Protest, Veränderung und Handeln setzt, betont „Relax for Future“ die Kraft der Reduktion und des Nicht-Handelns. Es ist also weniger eine politische Bewegung,
sondern mehr eine philosophische und spirituelle Haltung. Spannend ist die Frage, ob man diese Philosophie als ernsthafte ökologische Strategie oder eher als provokante Satire auf unsere
hyperaktive Gesellschaft verstehen sollte. Manche sehen darin eine Art „Zen für den Klimaschutz“, andere eher eine ironische Kritik an Aktivismus.
Kurz gesagt: „Relax for Future“ bedeutet, dass man durch Entschleunigung, Einfachheit und Gelassenheit automatisch nachhaltiger lebt – weil man weniger Ressourcen verbraucht und
gleichzeitig mehr Lebensqualität gewinnt.
Ein roter Faden und die Spur, die bleibt
Was bleibt, ist ein roter Faden: Aus der stillen Präzision des Showtechnikers entsteht der Blick des Inszenators, aus der mobilen Theaterarchitektur die temporäre Stadtbühne, aus Light Optics
eine Ethik des Lichts. Er unterscheidet Beleuchtung von Illumination, Funktion von Bedeutung, Effekt von Verantwortung. Seine Arbeit macht deutlich, dass Städte nicht nur aus Steinen bestehen,
sondern aus Beziehungen, die man sichtbar machen kann: zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Raum und Mensch, zwischen Technik und Gefühl. Augsburg ist dafür der Resonanzraum geworden –
nicht als Museum, sondern als lebendige Bühne, auf der Licht Orientierung gibt. Wolfgang F. Lightmaster hat der Stadt kein neues Gesicht gegeben; er hat ihr ermöglicht, das eigene zu erkennen.
Laudatio auf Wolfgang F. Lightmaster
erstellt von A. I. K. I. Microsoft "Copilot" - www.bing.com - GBT-5:
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,
heute ehren wir einen Mann, der wie kaum ein anderer gezeigt hat, was bürgerschaftliches Engagement für eine Stadt bedeuten kann: Wolfgang F. Lightmaster.
Wenn wir von Augsburg sprechen, sprechen wir von einer Stadt mit Geschichte, mit Kultur, mit Herz. Doch all dies bleibt nur Kulisse, wenn es nicht Menschen gibt, die diese Stadt mit Leben füllen.
Wolfgang Lightmaster ist einer dieser Menschen. Er hat nicht nur Projekte geschaffen – er hat Begegnungen ermöglicht, Brücken gebaut und Licht in unsere Stadt getragen.
Sein Name ist untrennbar verbunden mit dem Augsburger Kunsttunnel. Was einst eine graue Unterführung war, verwandelte er in eine Galerie, die täglich von Tausenden durchschritten wird. Ein Ort,
der zeigt: Kunst gehört nicht in elitäre Räume, sondern mitten ins Leben. Für dieses Projekt erhielt er den Augsburger Zukunftspreis – und vor allem die Dankbarkeit einer ganzen Stadt.
Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl würdigte dieses Engagement mit den Worten: „Wolfgang F. Lightmaster hat mit dem Kunsttunnel in reichem Maße zur Verbesserung der Außendarstellung der Stadt
beigetragen und sich damit um die städtische Gemeinschaft verdient gemacht.“
Doch er beließ es nicht dabei. Mit den Konzerten im Bürgerhof öffnete er Türen, die sonst verschlossen bleiben. Er machte den Innenhof des Verwaltungsgebäudes zu einer Bühne für alle – für Musik,
für Begegnung, für Gemeinschaft. Hier wurde Kultur zu einem Fest, das niemanden ausschloss.
Auch die Neubürgerempfänge im Rathaus tragen seine Handschrift. Unter dem Motto „Miteinander sprechen“ hieß er neue Bürgerinnen und Bürger willkommen und machte deutlich: Augsburg ist nicht nur
ein Wohnort, sondern eine Gemeinschaft, die offen ist für alle, die hier leben wollen. Oberbürgermeister Dr. Paul Wengert sagte dazu: „Herr Lightmaster war und ist eine stabile Stütze des
bürgerschaftlichen Engagements. Viele konstruktive Beiträge und Events sind durch ihn erst möglich geworden.“
Und schließlich die Stadtilluminationen: Mit Licht hat er Augsburg in Szene gesetzt, Brunnen und Gebäude in Farben getaucht, die unsere Stadt in neuem Glanz erstrahlen ließen. Diese
Illuminationen waren mehr als ein optisches Schauspiel – sie waren ein Symbol dafür, dass Augsburg eine Stadt ist, die sich ihrer Geschichte bewusst ist und zugleich mutig in die Zukunft
blickt.
Sehr geehrte Damen und Herren, Wolfgang F. Lightmaster hat uns gezeigt, dass Ehrenamt nicht im Stillen verharren muss. Es kann sichtbar sein, es kann strahlen, es kann eine ganze Stadt bewegen.
Er hat Augsburg nicht nur bereichert – er hat es heller gemacht, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.
Lieber Herr Lightmaster, im Namen all jener, die durch Ihr Wirken inspiriert, berührt und gestärkt wurden, sage ich: Danke. Danke für Ihre Ideen, Ihre Beharrlichkeit, Ihre Leidenschaft. Danke für
Ihr Licht.
RELAX FOR FUTURE www.relaxforfuture.de
"Eine gute Zukunft für uns alle als globalisierte Menschheit entsteht mehr durch das, was wir zukünftig nicht tun, als durch das, was wir tun." "Ich kann Frieden, nicht Krieg!" Wolfgang F. Lightmaster
-2026-1-